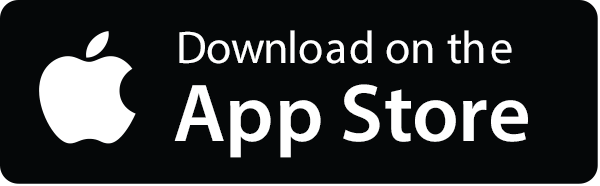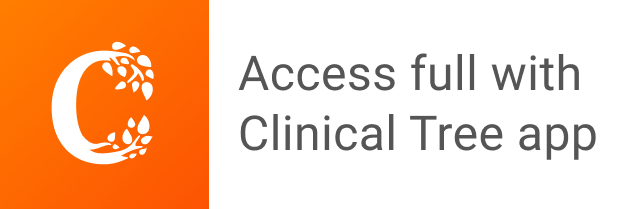© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016
Arnd T. May , Hartmut Kreß , Torsten Verrel, and Till Wagner (eds.), Patients’ Registrations 10.1007 / 978-3-642-10246-2_13
13. Principles of the legal regulation of patient occupations
(1)
Criminological Seminar, University of Bonn, Adenauerallee 24-42, 53113 Bonn, Germany
Torsten Verrel
Email: verrel@jura.uni-bonn.de
13.1 Importance and Limits of the Third Amendment Act
The commitment and implementation of patient interventions, which for a long time was the subject of controversial jurisprudence and which in practice repeatedly caused uncertainty, has been directed since September 1, 2009 according to §§ 1901a, b, 1904 BGB and §§ 287, 298 FamFG (3rd Act amending the Supporting Act of 29.07.2009, BGBl I 2009, p. 2286).
structure
These rules regulate in a very striking manner what the legislator conceptually understands under the precautionary measure of a patient ‘s prescription (in the following section 13.2), under which conditions, in the specific case, it acts as a binding force (section 13.3), which tasks the supervisor or the authorized physician of the (Section 13.4), but also in the case of missing and / or the statutory requirements of non-appropriate patient exposures (section 13.5). As expected, the first problems and disputes concerning the application of the law have not been left out (Section 13.6).
Die gesetzliche Absicherung nicht nur des Vorsorgeinstruments der Patientenverfügung, sondern auch des Vorgehens in der Mehrzahl der Fälle, in denen über medizinische Maßnahmen bei einwilligungsunfähigen Patienten zu entscheiden ist, die keine (verbindliche) Patientenverfügung verfasst haben, ist ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr Rechtssicherheit bei Behandlungsentscheidungen am Lebensende. Das Patientenverfügungsgesetz hat ebenso wie die neuere, in dem Beitrag von Rissing-van Saan (Kap. 14) erläuterte Strafrechtsprechung etliche Streitpunkte geklärt, mit denen diese Entscheidungen in rechtlicher Hinsicht in der Vergangenheit belastet waren. Nunmehr können alle Akteure, also Patienten, deren Angehörige, Betreuer, Bevollmächtigte, Ärzte, Pflegekräfte, Betreuungsgerichte und Berater dem Gesetz entnehmen, welche Voraussetzungen eine verbindliche Patientenverfügung erfüllen muss und wie die Aufgaben unter den Beteiligten verteilt sind.
Rechtssicherheit
Die Existenz eines gesetzlichen Rahmens sollte jedoch nicht zu der Erwartung führen, dass es fortan keine Probleme mehr im Umgang mit Patientenverfügungen und allgemein mit nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten gibt. Abgesehen davon, dass jedes und insbesondere jedes neue Gesetz der rechtlichen Auslegung bedarf, müssen die gesetzlich vorgegebenen Prüfungskriterien und Entscheidungsmaßstäbe in jedem Einzelfall ausgefüllt werden. Es wird nach wie vor zu Situationen der Erkenntnis- und Entscheidungsunsicherheit und auch dazu kommen, dass es mehrere, rechtlich gleichermaßen vertretbare Handlungsoptionen gibt.
Eine gesetzliche Regelung von Patientenverfügungen, die diese Vorsorgemöglichkeit absichern und nicht beschneiden will, kann insbesondere nichts an der grundsätzlichen Problematik von Vorausverfügungen, nämlich an ihrer Statik und Fehleranfälligkeit ändern, sondern kann nur versuchen, diese abzumildern. Die erfreuliche gesetzliche Anerkennung der Patientenverfügung zeigt in besonderer Deutlichkeit auf, dass die Zubilligung und Wahrnehmung von auch zukunftswirksamer Selbstbestimmung stets mit dem Risiko der Fehlentscheidung verbunden ist. Dieses Risiko muss jedoch auf sich nehmen, wer sich nicht dem Diktat des medizinisch Machbaren oder der Entscheidung anderer darüber unterwerfen will, was für ihn das Beste ist.
13.2 Legaldefinition der Patientenverfügung
Als Patientenverfügung definiert § 1901a Abs. 1 S. 1, 1. Halbsatz BGB die „schriftliche“ Festlegung eines „einwilligungsfähigen Volljährigen“, ob er „für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit“ in „bestimmte“, zum Zeitpunkt der Festlegung noch „nicht unmittelbar bevorstehende“ Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder „ärztliche Eingriffe einwilligt“ oder sie „untersagt“.
Das Wesen einer Patientenverfügung besteht demnach in einer Vorabentscheidung über den Umfang medizinischer Maßnahmen in einer künftigen, also lediglich antizipierten Situation krankheitsbedingter Entscheidungsunfähigkeit.
Durch diesen Vorausverfügungscharakter unterscheidet sich die Patientenverfügung von der in einer aktuellen Krankheitssituation abgegebenen Erklärung über die gewünschte bzw. abgelehnte Behandlung. Solche, unmittelbar bevorstehende medizinische Maßnahmen betreffende Willensäußerungen des einwilligungsfähigen Patienten haben stets Vorrang gegenüber etwaigen früheren mündlichen Äußerungen oder schriftlichen Festlegungen. Patientenverfügungen werden also überhaupt nur dann relevant, wenn der Patient aktuell einwilligungsunfähig ist und vor Eintritt dieses Zustands nicht mehr zu den jetzt medizinisch indizierten Maßnahmen befragt werden konnte.
13.2.1 Schriftform
Der Vorausverfügungen stets innewohnenden Gefahr einer Fehleinschätzung des künftigen Willens trägt in gewisser Weise das Schriftformerfordernis Rechnung, das zugleich aber auch einen zuverlässigeren Nachweis des früher Gewollten ermöglichen soll. Damit fallen lediglich mündliche Äußerungen des erst später einwilligungsunfähig gewordenen Patienten zwar nicht unter den gesetzlichen Begriff einer Patientenverfügung. Sie sind damit aber keineswegs bedeutungslos, sondern wichtige Anhaltspunkte für den ebenfalls zu beachtenden mutmaßlichen Willen (Abschn. 13.5).
13.2.2 Volljährigkeit
Entsprechendes gilt für die rechtlich und ethisch keineswegs unproblematische Beschränkung des Vorsorgeinstruments der Patientenverfügung auf Volljährige (kritisch u. a. Simon 2010, S. 99; Müller 2010, S. 182). Minderjährige können zwar keine nach § 1901a Abs. 1 BGB unmittelbar verbindlichen Patientenverfügungen abfassen, doch sind schriftliche (Nicht-)Behandlungswünsche Minderjähriger ebenfalls im Rahmen der Ermittlung ihres mutmaßlichen Willens zu beachten oder können – wie auch bei Volljährigen – der Dokumentation einer aktuell geäußerten Behandlungseinwilligung oder -verweigerung dienen.
13.2.3 Einwilligungsfähigkeit
Der Verfasser einer Patientenverfügung muss darüber hinaus zum Zeitpunkt ihrer Abfassung einwilligungsfähig gewesen sein, also die Bedeutung und Tragweite seiner Festlegungen erkannt und unbeeinflusst von Täuschung, Drohung oder Gewalt verfügt haben (näher zu den Anforderungen an die Einwilligungsfähigkeit Kap. 15). Solange aber keine konkreten Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen der Einwilligungsfähigkeit vorliegen, ist davon auszugehen, dass der Patient bei der Errichtung der Patientenverfügung einwilligungsfähig war.
13.2.4 Bestimmtheit
Eine praktisch sehr bedeutsame, vom Gesetzgeber schon auf begrifflicher Ebene vorgenommene Begrenzung liegt darin, dass § 1901a Abs. 1 BGB unter Patientenverfügungen nur solche schriftlichen Festlegungen versteht, die sich auf bestimmte ärztliche Maßnahmen beziehen.
Lediglich pauschale Formulierungen wie etwa „Ich möchte in Würde sterben/nicht an Schläuchen hängen/keine Apparatemedizin/keine Intensivstation“ genügen dem nicht, können aber wiederum bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens (Abschn. 13.5) Bedeutung erlangen. Eine Patientenverfügung im Sinne des Gesetzes muss die Art der medizinischen Maßnahme (z. B. künstliche Beatmung, Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr, Reanimation, kreislaufstabilisierende Medikation) und den Krankheitsfall, in dem die Vornahme oder Unterlassung dieser Maßnahmen gewünscht wird (z. B. Demenzerkrankung, irreversibler Bewusstseinsverlust, Lungenentzündung) so genau beschreiben, dass die Adressaten einer Patientenverfügung prüfen können, ob die Patientenverfügung auf die jetzt eingetretene Behandlungssituation zutrifft. Der Patient ist jedoch im Übrigen keinen Beschränkungen unterworfen, d. h. er kann Festlegungen im Hinblick auf jede medizinische Maßnahme (die nach § 216 StGB verbotene Tötung auf Verlangen fällt nicht darunter, näher dazu: Abschn. 14.3) und jeden Krankheitszustand treffen. Das ergibt sich aus der letztlich alle medizinischen Maßnahmen erfassenden Aufzählung in § 1901a Abs. 1 S. 1 2. Halbsatz BGB und der ausdrücklichen Feststellung in Abs. 3, dass die Regeln über Patientenverfügungen unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung gelten. Die im Gesetzgebungsverfahren diskutierte sog. Reichweitenbegrenzung (zu den konkurrierenden Gesetzesentwürfen s. Simon 2010, S. 68 f.) ist damit vom Gesetzgeber dezidiert verworfen worden.
13.3 Prüfung der konkreten Verbindlichkeit
Von der grundsätzlichen Wirksamkeit einer die gesetzlichen Begriffsmerkmale erfüllenden Patientenverfügung ist die für ihre Verbindlichkeit letztlich maßgebliche Frage zu unterscheiden, ob die in ihr antizipierte Lage mit dem tatsächlich eingetretenen Krankheitsfall übereinstimmt (Abschn. 13.3.1) und ob die früher getroffene Vorausverfügung nach wie vor Gültigkeit hat (Abschn. 13.3.2). Das Gesetz verlangt insoweit in § 1901a Abs. 1 S. 1 2. Halbsatz BGB die Prüfung, ob die Festlegungen „auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen“ und stellt in S. 3 klar, dass „eine Patientenverfügung (…) jederzeit formlos widerrufen werden (kann).“
Es ist also nicht so wie aber manche Ärzte und Angehörige meinen, dass schon die bloße Existenz einer Patientenverfügung oder auch nur eines so bezeichneten Dokuments Behandlungsbegrenzungen legitimiert.
13.3.1 Einschlägigkeit
Die Prüfung der Einschlägigkeit einer Patientenverfügung, d. h. ihrer Passgenauigkeit im Hinblick auf die konkrete klinische Situation des Patienten beinhaltet zunächst die Ermittlung des sich aus der Patientenverfügung ergebenden wirklichen Willens des Patienten. Im Idealfall sind dieser Wille und die Formulierungen in der Verfügung sowie die derzeitige Krankheitslage kongruent, so dass keine Zweifel an der Verbindlichkeit der Patientenverfügung bestehen. Es kann jedoch trotz eines vermeintlich eindeutigen und auf die aktuelle Situation zutreffenden Wortlauts der Patientenverfügung Anlass zu der Frage bestehen, ob deren Umsetzung tatsächlich dem seinerzeit geäußerten Willen des Patienten entsprechen würde. Wer etwa verfügt hat, dass er im Falle eines Komas, keine (bestimmten) lebenserhaltenden Maßnahmen wünscht, bezieht damit auch eine nur vorübergehende Bewusstlosigkeit, also reversible Krankheitszustände mit ein. Es dürfte aber regelmäßig nicht dem Willen eines Patienten entsprechen, auf eine Erfolg versprechende, keine Folgeschäden erwarten lassende Therapie zu verzichten bzw. bedürfte es weiterer Anhaltspunkte in der Verfügung, dass ein derart weit reichendes Verständnis wirklich gewollt war.
Keine Beschränkung auf inkurable Erkrankungen
Wegen der fehlenden Reichweitenbegrenzung können in einer Patientenverfügung auch aussichtsreiche Behandlungsmaßnahmen abgelehnt werden. So verfügen mitunter alte Menschen, die mit ihrem Leben in Frieden abgeschlossen haben, dass sie bei einem Schlaganfall oder einer Lungenentzündung nicht kurativ behandelt werden oder keine ihr Leben rettende Beinamputation wollen. Als besonders eindringliches Beispiel für Verfügungen, in denen sogar eine vollständige Genesung versprechende medizinische Behandlung untersagt wird, seien die von Zeugen Jehovas abgelehnten Bluttransfusionen genannt (Kap. 6).
Anlass zu einer Interpretation von Patientenverfügungen besteht vor allem dann, wenn deren Festlegungen in medizinischer Hinsicht nicht (exakt) mit dem derzeitigen Krankheitsbild übereinstimmen. Würde man aus jeder noch so kleinen Abweichung stets den Schluss fehlender Verbindlichkeit ziehen, gäbe es kaum noch rechtswirksame Patientenverfügungen. Die absehbare Folge wären seitenlange Patientenverfügungen, die alle erdenklichen Krankheitszustände zu erfassen suchen, die aber gerade wegen dieser Präzision bzw. wegen der Vielfalt medizinischer Situationen und Verläufe wieder Raum für Divergenzen geben (Müller 2010, S. 181).
Adressaten einer Patientenverfügung sollten daher wissen, dass Patientenverfügungen wie andere Willensäußerungen auch einer Auslegung zugänglich und nicht selten auch bedürftig sind (BT-Drs. 16/8442, S. 21, BGH, Beschluss v. 17.9.2014– Az. XII ZB 202/13, S. 17). § 133 BGB, der auf Patientenverfügungen jedenfalls der Sache nach Anwendung findet, sieht ausdrücklich vor, dass „bei der Auslegung einer Willenserklärung (…) der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften (ist).“ Es geht also darum, den Wortlaut einer Patientenverfügung unter Heranziehung der Kenntnisse über den Patienten und der Begleitumstände seiner Erkrankung so auszulegen, dass das bei der Abfassung der Verfügung tatsächlich Gewollte ermittelt wird.
Gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass auch diese Auslegung an Grenzen stößt, wenn letztlich unklar bleibt, was der Patient wirklich gewollt hat. Da bei verbleibenden Zweifeln regelmäßig nach der Regel in dubio pro vita (lat. „Im Zweifel für das Leben“) entschieden, d. h. eine lebenserhaltende Therapie durchgeführt wird, kann es zu einer vom Patienten gerade nicht gewünschten Behandlung kommen. Derartige Defizite von Patientenverfügungen sind zumeist auf unzureichende Kenntnisse ihrer Verfasser über die in Betracht kommenden Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten zurückzuführen.
Daher ist Patienten, die nicht riskieren wollen, dass ihre Verfügung wegen mangelnder Klarheit oder auch Passgenauigkeit unbeachtet bleibt, dringend eine qualifizierte ärztliche Beratung zu empfehlen.
13.3.2 Fortdauernde Geltung
Selbst wenn eine aussagekräftige und in klinischer Hinsicht passgenaue Patientenverfügung vorliegt, folgt daraus nicht automatisch ihre Verbindlichkeit. Denn es muss außerdem geprüft werden, ob der in der Verfügung zum Ausdruck gekommene Wille noch mit dem aktuellen Willen des Patienten – das Gesetz spricht insoweit von der aktuellen Lebenssituation – übereinstimmt.
Da die Patientenverfügung eine Vorabentscheidung für eine unter Umständen erst lange Zeit nach ihrer Errichtung eintretende krankheitsbedingte Einwilligungsunfähigkeit ist, kann es bis dahin aus unterschiedlichen Gründen zu einer Willensänderung kommen. Sei es, dass sich die Lebensumstände grundlegend geändert haben, der Patient z. B. eine Familie gegründet oder Enkelkinder bekommen hat, sich neue Therapiemöglichkeiten ergeben haben oder dass der Patient wider seine Erwartung trotz erheblicher krankheitsbedingter Beeinträchtigungen doch Lebenswillen hat und behandelt werden möchte.
Widerruf
Der deutlichste Ausdruck einer Willensänderung ist der regelrechte Widerruf einer Patientenverfügung, der anders als sie nicht schriftformgebunden ist, also auch mündlich und selbst durch schlüssiges Handeln erfolgen kann (§ 1901a Abs. 1 S. 3 BGB).
So wichtig das Erfordernis eines Abgleichs der Patientenverfügung mit dem aktuellen Willen des Patienten ist, um ihn davor zu bewahren, an eine überholte Patientenverfügung gekettet zu bleiben, so wenig darf dieser Prüfungspunkt zu bloßen Spekulationen über eine Willensänderung und damit zu einer Aushebelung von Patientenverfügungen führen. Vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte für eine Willensänderung vorliegen, um eine ansonsten wirksame Patientenverfügung nicht befolgen zu dürfen. Es bedarf von Gesetzes wegen auch keiner regelmäßigen Bestätigung oder Erneuerung einer Patientenverfügung, und es ist auch keine Frist bestimmt, nach deren Ablauf eine Patientenverfügung automatisch ihre Wirkung verliert. Freilich empfiehlt es sich, eine länger zurückliegende Patientenverfügung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um die Feststellung ihrer fortdauernden Gültigkeit zu erleichtern.
13.4 Die an der Umsetzung einer Patientenverfügung beteiligten Personen und ihre Aufgaben
Das Gesetz weist in § 1901a Abs. 1 S. 1 2. Halbsatz dem gerichtlich bestellten Betreuer (s. Kap. 16) oder einem ggf. vorhandenen, dem Betreuer in seinen Rechten gleichgestellten Bevollmächtigten des Patienten (§§ 1901a Abs. 5, 1901b Abs. 3, 1904 Abs. 5 BGB) die Aufgabe zu, die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung zu prüfen und bei einem positiven Ergebnis „dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen“. Dagegen fällt die Indikationsstellung in die alleinige Kompetenz des Arztes (§ 1901b Abs. 1 S. 1 BGB), was deswegen von Bedeutung ist, weil der (vorausverfügte) Patientenwille nur im Rahmen medizinisch indizierter Maßnahmen beachtlich ist. Der Patient bzw. der seine Verfügung umsetzende Betreuer oder Bevollmächtigte kann also nur die Vornahme oder die Begrenzung medizinisch indizierter Maßnahmen verlangen.
Ungeachtet dieser klaren Rollenverteilung sieht das Gesetz eine im Dialog zwischen Arzt und Betreuer/Bevollmächtigtem zu treffende Behandlungsentscheidung vor: „Er (der Arzt) und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende Entscheidung“ (§ 1901b Abs. 1 S. 2).
Doppelrolle des Arztes
Die Aufgabe des Arztes erschöpft sich also nicht in der Indikationsstellung, sondern besteht auch darin, im Rahmen seiner Kenntnis des Patienten zur Klärung der Verbindlichkeit der Patientenverfügung beizutragen.
Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen des Patienten haben demgegenüber keine eigenen Verfahrensrechte, sollen aber nach Möglichkeit als wichtige Informationsquellen für die Ermittlung des Patientenwillens in die Entscheidungsfindung einbezogen werden (§ 1901b Abs. 2 BGB). Abgesehen davon empfiehlt es sich schon deswegen, ein Gespräch mit allen Beteiligten, also auch mit den im Gesetz nicht ausdrücklich genannten Pflegekräften zu führen, um ein aus Verärgerung oder Unkenntnis resultiertes juristisches Nachspiel zu vermeiden.
Ein Konsens aller Beteiligten ist demnach anzustreben, aber keineswegs Entscheidungsvoraussetzung.
Letztlich hat allein der Betreuer/Bevollmächtigte das Mandat, über die Verbindlichkeit der Patientenverfügung zu entscheiden. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn kein Einvernehmen mit dem Arzt über die Beurteilung der Patientenverfügung besteht. In einem solchen Konfliktfall muss der Betreuer/Bevollmächtigte eine betreuungsgerichtliche Genehmigung für die von ihm beabsichtigte Nichteinwilligung in eine indizierte lebenserhaltende Behandlung einholen (§ 1904 Abs. 4 BGB). Das Betreuungsgericht kann darüber hinaus bei Unsicherheit über die Beurteilung des Patientenwillens vom Betreuer/Bevollmächtigten sowie stets von jedermann dann angerufen werden, wenn der Verdacht eines Missbrauchs der Vertretungsmacht durch den Betreuer/Bevollmächtigten besteht. Hat das Betreuungsgericht eine Genehmigung für die vom Betreuer/Bevollmächtigten verlangte Behandlungsbegrenzung erteilt, wird diese erst nach zwei Wochen wirksam (§ 287 Abs. 3 FamFG), um den anderen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, noch rechtzeitig Rechtsmittel gegen die Genehmigung einzulegen.
13.5 Vorgehen bei fehlender Patientenverfügung
Wird ein Patient krankheitsbedingt einwilligungsunfähig, ohne dass er unmittelbar davor zu seinen Behandlungswünschen befragt werden konnte, und hat er auch keine oder nur eine den gesetzlichen Verbindlichkeitsanforderungen nicht entsprechende Patientenverfügung verfasst, richtet sich die Behandlungsentscheidung nach seinem mutmaßlichen Willen, was nunmehr § 1901a Abs. 2 BGB ausdrücklich regelt, aber auch schon zuvor Stand der Rechtsprechung war (BGHSt 40, S. 257, S. 263).
Gegenüber der Maßgeblichkeit und der Ermittlung des mutmaßlichen Willens bestehen vielfach noch erhebliche Vorbehalte. Sie beruhen zum einen auf der Sorge, dass diese Rechtsfigur zu spekulativen, von Drittinteressen gesteuerten oder durch unzulässige Lebenswertbetrachtungen geprägten „Mutmaßungen“ über das vermeintlich vom Patienten Gewollte führt (Höfling 2006, S. 116). Zum anderen wird bezweifelt, dass es überhaupt möglich ist, den mutmaßlichen Willen eines einwilligungsunfähigen Patienten zuverlässig zu ermitteln. Bezeichnender Weise werden solche Bedenken zumeist nur geäußert, wenn mutmaßlich gewünschte Behandlungsbegrenzungen in Rede stehen, während man offenbar ohne weiteres davon ausgeht, dass die Vornahme lebenserhaltender Maßnahmen dem Patientenwillen entspricht. Dahinter steht gewiss die Erfahrung, dass Menschen weiterleben und daher behandelt werden wollen. Außerdem scheint das Risiko eines irrtümlich gemutmaßten Behandlungswillens eher hinnehmbar zu sein als das der fehlerhaften Annahme eines mutmaßlichen Behandlungsverzichts.
Kann der mutmaßliche Wille des Patienten nicht ermittelt werden, gilt die Entscheidungsregel in dubio pro vita.
Diese Regel kommt aber nur dann zum Tragen, wenn tatsächlich Unsicherheit darüber besteht, welche Behandlungsentscheidung dieser Patient, könnte er jetzt noch befragt werden, treffen würde. Vielfach werden aber die vom Gesetz verlangten, bloße Spekulationen ausschließenden „konkreten Anhaltspunkte“ (§§ 1901a Abs. 2 S. 2) für den individuellen Patientenwillen vorliegen, etwa weil „frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen“ des Patienten, seine „ethische(n) oder religiöse(n) Überzeugungen“ oder „sonstige(n) persönliche(n) Wertvorstellungen“ bekannt und aussagekräftig sind. Außerdem ermöglicht die heutige Medizin die Aufrechterhaltung auch solcher Krankheitszustände, bei denen die Gewissheit der Regel, dass jedes Leben weiterleben will (Höfling 2006, S. 117), schwindet.
Betreuer/Bevollmächtigter und Arzt, die in gleicher Weise für die Ergründung und Beachtung des mutmaßlichen Willens zuständig sind wie für die Prüfung und Umsetzung einer Patientenverfügung, sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Beurteilung des mutmaßlichen Willens keine – ohnehin niemals zu erreichende – absolute Sicherheit verlangt.
Anhaltspunkte
Die Beurteilung muss auf einer belastbaren Tatsachengrundlage beruhen, in die sowohl die über den Patienten verfügbaren Informationen, insbesondere über seine Einstellung zu Krankheit, Leiden und Alter, als auch die für seine Krankheitslage und Behandlungsaussichten maßgeblichen medizinischen Fakten eingehen. Es bestehen keine erhöhten Beweisanforderungen, wenn der Tod des Patienten noch nicht unmittelbar bevorsteht (BGH, Beschluss v. 17.09.2014 – Az. XII ZB 202/13, S. 18 f.).
Auch hier wird sich ein umfassendes Bild regelmäßig nur durch die Befragung aller Beteiligten ergeben. Sollte dieses Bild unklar bleiben, sind die medizinisch indizierten Maßnahmen durchzuführen.
Betreuungsgericht
Besteht ein Dissens zwischen dem Betreuer/Bevollmächtigtem und dem Arzt darüber, ob eine Behandlungsbegrenzung dem mutmaßlichen Patientenwillen entspricht, muss wiederum das Betreuungsgericht angerufen werden.
13.6 Anwendungsprobleme
Es kann nicht verwundern, dass die Umsetzung des Patientenverfügungsgesetzes in der Praxis, aber auch in der Rechtswissenschaft zu einigen Streitpunkten geführt hat.
13.6.1 Bestimmtheitsanforderungen
Nicht überschätzt werden sollte die Auseinandersetzung darüber, welches Maß an Bestimmtheit das Gesetz für eine Patientenverfügung verlangt. Denn selbst wenn man einen engen Bestimmtheitsbegriff anlegt (Albrecht und Albrecht 2009, S. 428 f.), sind die Verfügungen, die dieser Anforderung nicht genügen, zwar keine Patientenverfügungen im Sinne des Gesetzes, aber als gewichtiger Indikator (§ 1901a Abs. 2 nennt ausdrücklich „frühere schriftliche Äußerungen“!) für den dann zu eruierenden mutmaßlichen Willen durchaus beachtlich.
13.6.2 Notwendigkeit einer Betreuerbestellung
Relevanter ist dagegen der Streit darüber, ob eine Patientenverfügung immer nur durch einen Betreuer/Bevollmächtigten umgesetzt oder auch unmittelbar vom Arzt eines bisher nicht vertretenen Patienten beachtet werden kann. Freilich muss auch dieses Problem relativiert werden, da in Patientenverfügungen festgelegte Behandlungsbegrenzungen zumeist an die Prognose der Inkurabilität anknüpfen, für die aber in aller Regel der Therapieverlauf abgewartet werden muss, so dass für den während dieser Zeit entscheidungsunfähigen Patienten ohnehin eine Betreuerbestellung notwendig ist bzw. ein vom Patienten eingesetzter Bevollmächtigter hinzugezogen werden muss.
Notfallsituation
Es kann aber vor allem bei Notfällen oder rapiden Krankheitsverläufen bisher nicht vertretener Patienten zu der Situation kommen, dass die in einer validen Patientenverfügung beschriebene Lage sogleich eintritt. Sofern dem Arzt in der Kürze der Zeit eine Prüfung der Wirksamkeitsvoraussetzungen möglich ist, etwa weil er den Patienten und den in seiner Verfügung dokumentierten Willen gut kennt, wäre es verfehlt, auf der Bestellung und Entscheidung eines Vertreters zu bestehen und den Patienten bis dahin einer von ihm offensichtlich nicht gewollten Behandlung zu unterziehen.
Man denke nur an den mit der Krankheit und den Wünschen seines Patienten bestens vertrauten Hausarzt, der im Notfall zu ihm gerufen wird und erkennt, dass der in der Patientenverfügung geregelte Fall eingetreten ist und nun gezwungen wäre, lebenserhaltende Maßnahmen einzuleiten, um eine Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten über eine Therapiebegrenzung zu ermöglichen.
Dieses intuitiv gewonnene Ergebnis der direkten Bindungswirkung von Patientenverfügungen lässt sich auch rechtlich absichern (Götz in Palandt 2015, § 1901a Rn. 15, 24; Verrel 2010, S. 38 ff.; Bundesärztekammer 2013, S. A1585; zur Gegenansicht Diehn und Rebhan 2010, S. 329). Zwar richten sich die Vorschriften über die Umsetzung von Patientenverfügungen und des subsidiären mutmaßlichen Willens allein an den Betreuer/Bevollmächtigten (§ 1901a Abs. 1 S. 1: „[…] der Betreuer [hat] dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen“. Abs. 2 S. 1: „[…] hat der Betreuer den […] mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden […]“.). Daraus folgt auch, dass bei einer bereits eingerichteten Betreuung bzw. einer wirksamen Bevollmächtigung der vom Gesetz vorgesehene dialogische Entscheidungsprozess eingehalten werden muss, sofern es sich nicht um eine sofort vom Arzt zu treffende Eilentscheidung handelt. Damit ist aber nicht gesagt, dass Patientenverfügungen bei noch nicht geregelter Stellvertretung keine unmittelbare Wirkung entfalten, zumal Patientenverfügungen üblicherweise an Ärzte und nicht an Patientenvertreter gerichtet sind. Noch gewichtiger ist die Überlegung, dass der Patient durch die Errichtung einer wirksamen Patientenverfügung bereits selbst eine Regelung getroffen hat, insofern also gar keiner Vertretung durch andere Personen, sondern allenfalls deren Durchsetzungshilfe bedarf (so jetzt auch der BGH in seiner Entscheidung vom 17.09.2014 – Az. XII ZB 202/13, S. 8). Abschließend sei aber noch einmal darauf hingewiesen, dass Ärzte nur eindeutige, keinen Anlass zu weiterer Überprüfung gebende Patientenverfügungen ohne Mitwirkung eines Vertreters umsetzen sollten.
13.6.3 Bindungswirkung bei Demenz
Ein weiteres, sowohl rechtlich als auch ethisch besonders schwieriges Problem ergibt sich, wenn in einer Patientenverfügung ein Behandlungsverzicht für den Fall einer späteren Demenzerkrankung verfügt wurde, der dann tatsächlich dement gewordene Patient aber belastbare (!) Anzeichen von Lebensfreude zeigt und jetzt eine medizinische Behandlung benötigt, die er in der Patientenverfügung ausgeschlossen hat.
Rechtlicher Anknüpfungspunkt ist die Frage, ob der – hier durch schlüssiges Verhalten in Betracht kommende – Widerruf einer Patientenverfügung ebenso wie deren Errichtung Einwilligungsfähigkeit voraussetzt, also die bei einem Dementen gerade nicht mehr vorhandene Fähigkeit zur Erfassung der Bedeutung und Tragweite der Vornahme bzw. des Unterlassens medizinischer Eingriffe (Kap. 15) oder ob für einen solchen actus contrarius (lat. „gegenteilige Handlung“) ein natürlich-kreatürlicher Wille genügt (so u. a. Kutzer 2004, S. 687).
Bedenkt man, dass der verantwortlich handelnde Verfasser einer Patientenverfügung eine ganz bewusste und reflektierte Entscheidung darüber getroffen hat, dass er eine als seiner unwürdig empfundene und auch seine Angehörigen belastende Persönlichkeitsveränderung nicht durch lebenserhaltende Maßnahmen aufrechterhalten will, während er im Stadium der Demenz nicht mehr zu einer Reflektion seiner Situation in der Lage ist, und die Annahme eines kreatürlichen Lebenswillens nur das Ergebnis der Einschätzung Dritter ist, spricht mehr für die Fortgeltung der Patientenverfügung. Jedenfalls dürfte das selbst gewählte Risiko, sich durch eine Patientenverfügung womöglich zu „versklaven“ das geringere im Vergleich zu dem der Versklavung durch eine andere Person sein (Simon 2010, S. 87).
13.6.4 Umfang der Bevollmächtigung
Unterschiedliche Meinungen werden auch dazu vertreten, welche Folgen das Patientenverfügungsgesetz für die an eine Vorsorgevollmacht (s. Kap. 17) zu stellenden Konkretisierungsanforderungen hat (ausführlich dazu Müller 2010, S. 183 ff.). Die ganz überwiegende, dem Willen des Gesetzgebers Rechnung tragenden und dem Wortlaut von § 1904 Abs. 5 S. 2 BGB keinen Zwang antuende Ansicht geht davon aus, dass der Bevollmächtigte nur dann zur Umsetzung eines vorausverfügten oder mutmaßlich gewünschten Verzichts auf eine lebenserhaltende Behandlung befugt ist, wenn seine schriftliche Vollmacht diese Entscheidung ausdrücklich umfasst. Legt der Bevollmächtigte also nur eine auf die Vornahme ärztlicher Maßnahmen bezogene oder gar nur ganz pauschal formulierte Vollmacht vor, hat er kein Mandat, über Behandlungsbegrenzungen zu entscheiden. Dies hat die bei ihm, aber auch anderen Beteiligten oftmals auf Unverständnis stoßende Konsequenz, dass trotz einer Vorsorgevollmacht doch noch ein Betreuer zur Umsetzung des Patientenwillens bestellt werden muss. Etwas anderes mag dann gelten, wenn der unter Abschn. 13.6.2 besprochene Fall einer zweifelsfreien Patientenverfügung vorliegt. Denn es macht im Ergebnis keinen Unterschied, ob ein für die Entscheidung über einen Behandlungsabbruch nicht befugter Bevollmächtigter auftritt oder bisher gar kein Stellvertreter des Patienten vorhanden ist.
Folgt man der herrschenden Ansicht, ergibt sich die Folgefrage, ob die inhaltlichen Anforderungen an umfassende Gesundheitsvollmachten nur für die nach dem Inkrafttreten des Patientenverfügungsgesetzes am 01.09.2009 ausgestellten Vollmachten gelten oder auch Altfälle erfassen. Eine solche Rückwirkung wäre zwar im Stellvertretungsrecht ganz unüblich und ist nur in einer einhellig kritisierten Entscheidung des OLG Zweibrücken aus dem Jahr 2002 (OLG Zweibrücken FamRZ 2003, S. 113) angenommen worden. Um sich aber keinen Legitimationsproblemen auszusetzen, sollten alte Vollmachten, die nicht ohnehin schon die Befugnis zu Behandlungsbegrenzungen umfassen, an die neue Rechtslage angepasst und überarbeitet werden.
13.6.5 Patientenverfügung und Organspende
Die gesetzliche Anerkennung von Patientenverfügungen hat schließlich zu Verunsicherung darüber geführt, wie sich eine vorausverfügte Behandlungsbegrenzung zu einer vom Patienten in einem Organspendeausweis dokumentierten Bereitschaft zur postmortalen Organspende (s. Kap. 29) verhält. Diese beiden Erklärungen scheinen sich auf den ersten Blick zu widersprechen, da die Durchführung einer Organspende die Feststellung des Hirntods (s. Kap. 28) voraussetzt, die Hirntoddiagnostik aber die vorübergehende Aufrechterhaltung der Herz-Kreislauffunktionen, insbesondere eine künstliche Beatmung und damit lebenserhaltende Maßnahmen verlangt, die der Patient in seiner Patientenverfügung gerade untersagt hat. Die Zusammenschau beider Erklärungen kann aber zu der Auslegung führen, dass der Patient zwar keine Fortführung intensivmedizinischer Maßnahmen wünscht, die seinen Sterbeprozess in die Länge ziehen, wohl aber mit einer zeitlich eng begrenzten, nur zur Hirntodfeststellung und anschließenden Organentnahme erforderlichen Aufrechterhaltung seiner Vitalfunktionen einverstanden ist. Auf diese Weise wird sowohl der Wille des Patienten respektiert, sterben zu dürfen als auch seinem Einverständnis mit einer Organentnahme Rechnung getragen. Im Einzelnen können sich aber sehr unterschiedliche Fallkonstellationen ergeben, sowohl was die klinische Situation als auch das Vorliegen von Organspendeerklärung und Patientenverfügung betrifft.
Formulierungshilfen
Über die sich dabei ergebenden rechtlichen und ethischen Bewertungen informiert ein Arbeitspapier der Bundesärztekammer (Bundesärztekammer 2013b; s. auch Verrel 2012, S. 121 ff.). Darin sind Empfehlungen für Patienten, Patientenvertreter, Angehörige und Ärzte sowie Textbausteine für Patientenverfügungen enthalten, die zu mehr Entscheidungssicherheit in der besonders belastenden Situation der Abklärung der Voraussetzungen einer Organspende beitragen können.
Literatur
Albrecht A, Albrecht E (2009) Die Patientenverfügung – jetzt gesetzlich geregelt. Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern 2009:426–435
Bundesärztekammer (2013a) Empfehlungen der Bundesärztekammer und der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis. Dtsch Arzteblatt 110:A1580–A1585
Bundesärztekammer (2013b) Arbeitspapier zum Verhältnis von Patientenverfügung und Organspendeerklärung. Dtsch Ärzteblatt 110:A7–A9
Diehn T, Rebhan R (2010) Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. NJW 63:326–331
Götz I (2015) §§ 1616–1921. In: Palandt O (Hrsg) Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 74. Aufl. Beck, München, S 2017–2230
Höfling W (2006) Forum: „Sterbehilfe“ zwischen Selbstbestimmung und Integritätsschutz. JuS 40:111–118
Kutzer K (2004) Probleme der Sterbehilfe – Entwicklung und Stand der Diskussion. FPR 10:683–689
Müller G (2010) Patients who are subject to the 3rd Act on the Change of Careers Act: everything is regulated and much unresolved. DNotZ 105: 169-188
Simon A (2010) Medical aspects. In: German Reference Center for Ethics in the Life Sciences (DRZE) (Hrsg). Legal and ethical aspects. Alber, Freiburg i. Br., S 59-109
Verrel T (2010) Legal aspects. In: German Reference Center for Ethics in the Life Sciences (DRZE) (Hrsg). Legal and ethical aspects. Alber, Freiburg i. Br., S 13-57
Verrel T (2012) Patient allocation, therapy limitation and organ donation. Comments on a supposed contradiction. GuP 2: 121-126
[/ Membership]
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree